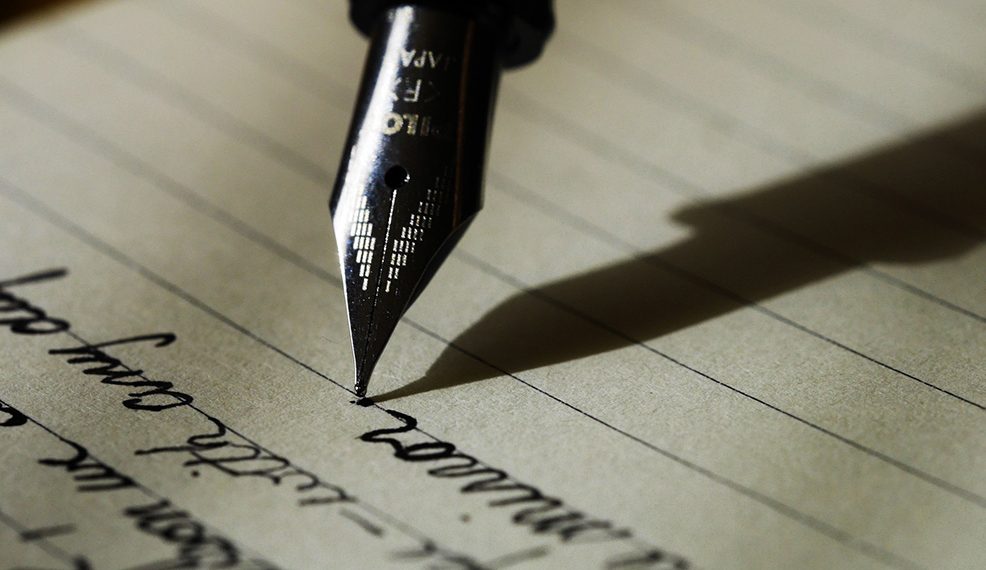Offener Brief
Bezüglich erheblicher inhaltlicher Fehler und methodischer Mängel des Artikels „Beyond Feminism? Jineolojî and the Kurdish Women’s Freedom Movement“ („Jenseits des Feminismus? Jineolojî und die kurdische Frauenbefreiungsbewegung“) von Nadje Al-Ali und Isabel Käser, der in der Zeitschrift Politics & Gender (Politik & Geschlecht) veröffentlicht wurde, hat das Jineolojî-Komitee Europa einen Brief an die Herausgeber_innen der Zeitschrift geschickt. Auf der Grundlage des Rechts auf Gegendarstellung bat das Jineolojî-Komitee die Redaktion um die Möglichkeit, einen eigenen Artikel zu schreiben, der in der Zeitschrift veröffentlicht werden sollte.
Nach längerer Zeit schrieb die Redaktion der Zeitschrift einen Antwortbrief, in dem sie auf diese Bitte nicht einging. Stattdessen verlangten sie Beweise für die Beanstandungen des Jineolojî-Komitees, um weitere Nachforschungen anstellen zu können. In dieser Situation entstand das Bedürfnis, unsere Kritik an dem Artikel mit der Öffentlichkeit zu teilen. Im folgenden Text wollen wir unsere Haltung zu dem erwähnten Artikel zum Ausdruck bringen, der geschrieben wurde, ohne die grundlegenden Quellen und Veröffentlichungen der Jineolojî zu lesen und ohne Nachforschungen an Orten durchzuführen, an denen die Arbeiten der Jineolojî entwickelt werden.
17. Februar 2021,
Jineolojî-Komitee Europa
An die Redaktion von Politics & Gender,
Wir schreiben diesen Brief als Antwort auf den Artikel „Beyond Feminism? Jineolojî and the Kurdish Women’s Freedom Movement“, verfasst von Nadje Al-Ali und Isabel Käser und veröffentlicht in Ihrer Zeitschrift 2020. Im Folgenden haben wir unsere Einwände gegen diesen Artikel aufgeführt. Wir finden es inakzeptabel, dass der Artikel feministische Methoden vernachlässigt und uns und die Jineolojî – die Wissenschaft der Frau und des Lebens, die wir entwickeln – objektiviert. Er stellt verschiedene Aspekte unserer Praxis falsch dar und verbreitet falsche Informationen. Aus diesen Gründen möchten wir unsere Enttäuschung über die Entscheidung der Gutachter_innen und Redakteur_innen zum Ausdruck bringen, diesen Artikel für die Veröffentlichung geeignet zu halten. In Anbetracht der grundlegenden Prinzipien, die als Ergebnis der zahlreichen Fälle entwickelt wurden, in denen Frauen aus dem Globalen Süden, Schwarze Feminist_innen, indigene und migrantische Frauen das „Othering“ von nicht-westlichen Frauen durch weiße Feminist_innen entlarvt haben, sind wir überrascht, dass ein Artikel, der genau das tut – das Othering indigener kurdischer Frauen und unserer Frauenbewegung – in Ihrer Zeitschrift veröffentlicht wurde.
Bis jetzt haben wir als Frauen der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung unsere Türen allen geöffnet, die über uns recherchieren und schreiben wollten. Diese Offenheit entspringt unserem Wunsch, den Kampf zu vermitteln und offenzulegen, den wir auf unserem Land gegen die Kolonisierung durch vier Nationalstaaten und gegen die andauernde Verleugnung unserer Identität und unseres Existenzrechts führen. Unsere Offenheit entspringt auch unserer Verpflichtung, anderen Kämpfen die Hand zu reichen mit dem Ziel, Allianzen zu bilden. Inzwischen haben wir auch wichtige Schritte unternommen, um unsere Identitäten zu unseren eigenen Bedingungen zu vertreten. Offen gesagt sind wir fassungslos, dass ein Artikel, der im Wesentlichen orientalistisch und herablassend gegenüber den Menschen ist, die er erforscht, der methodisch unbegründet ist und ethische Standards vernachlässigt, in einer angesehenen akademischen Zeitschrift veröffentlicht werden konnte. Um uns vor zukünftigem Schaden zu schützen, ist uns klar, dass wir in Zukunft bei Forschungsaufträgen selektiver vorgehen müssen. Im Folgenden finden Sie unsere Einwände gegen den Artikel in drei Abschnitte unterteilt, nämlich Methodik, Inhalt und Argumentation.
Beginnen wir mit den Problemen, die sich auf die methodische Vorgehensweise des Artikels beziehen:
1. Am Anfang des Artikels geben die Autor_innen an, dass sie insgesamt 120 kurdische Frauen im Rahmen verschiedener von ihnen durchgeführten Untersuchungen interviewt haben. Sie verzichten jedoch darauf, zu konkretisieren, wie viele dieser 120 Frauen, die sie für ihre Projekte interviewt haben, sich tatsächlich in diesem speziellen Artikel wiederfinden und in welchem Umfang. Auch werden keine kontextuellen und methodischen Informationen über die spezifischen Interviews gegeben, die für diesen speziellen Artikel durchgeführt wurden. Diejenigen von uns, die von ihnen interviewt wurden, sehen jedoch, dass unsere Worte, die im Artikel als Beweis für ihre verschiedenen Thesen präsentiert werden, völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Anstatt unsere Aussagen vollständig wiederzugeben, werden bestimmte Teile herausgeschnitten und instrumentalisiert, um den Argumenten der Autor_innen zu entsprechen.
2. Die Autor_innen scheinen sich nicht mit der wachsenden Anzahl an Veröffentlichungen auseinandergesetzt zu haben, über die sie epistemologische Behauptungen aufstellen. In der Tat lässt das Eingeständnis in der ersten Fußnote des Artikels Zweifel an der Gültigkeit und Zuverlässigkeit des Artikels aufkommen. Die Fußnote besagt, dass für diesen Artikel keine Quellen in kurdischer und türkischer Sprache konsultiert wurden. Dies ist auffällig, da dies die beiden Hauptsprachen sind, die Informationen über die Jineolojî verbreiten/veröffentlichen. So sind beispielsweise die beiden Jineolojî-Sendungen, die von Jin TV ausgestrahlt werden und in denen die Autor_innen Interviews führten, eine auf Türkisch und eine auf Kurdisch. Es scheint auch, dass die Autor_innen keine der Publikationen konsultiert haben, die die theoretischen und konzeptionellen Begriffe innerhalb der Jineolojî ausarbeiten, wie z.B. das Jineolojî-Magazin, das regelmäßig alle drei Monate in türkischer Sprache erscheint. Das Magazin hat gerade seine 20. Ausgabe veröffentlicht. Darüber hinaus scheinen die Hauptpublikationen „Jineolojî Tartışmaları“ (Jineolojî-Diskussionen) aus dem Jahre 2015 und „Jineolojî’ye Giriş“ (Einführung in die Jineolojî) aus dem Jahre 2016 nicht gelesen worden zu sein.
3. Andererseits schreiben Al-Ali und Käser: „Der Großteil der Jineolojî-Forschung findet in Rojava statt, wo die Autonomieverwaltung Jineolojî in den offiziellen Lehrplan aufgenommen hat und eine Jineolojî-Akademie und eine Jineolojî-Fakultät an der Rojava-Universität in Qamishlo eingerichtet wurden“ (S.12). Interessanterweise und entgegen ihrer eigenen Aussage scheinen die Autor_innen mit niemandem gesprochen zu haben, der an diesen Bemühungen beteiligt war.
4. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Beziehung zwischen der Forschungsfrage und der Methodik. Wir fragen uns, wenn es, wie auf Seite 5 angegeben, Ziel des Artikels war, die Bedeutung zu untersuchen, die Frauen der Jineolojî geben, warum wurde die Forschung nicht entsprechend konzipiert? Warum haben die Autor_innen es versäumt, sich systematisch mit den Interpretationen auseinanderzusetzen, die verschiedene Frauen von Jineolojî haben, und stattdessen jede Aussage ihrer Interviewpartner_innen als Beweis für eine andere Behauptung verwenden, die sie (die Autor_innen) über Jineolojî aufgestellt haben? Außerdem weichen die Autor_innen im weiteren Verlauf des Artikels von ihrer ursprünglichen Forschungsfrage ab, ohne dies zu erklären. Stattdessen verschiebt sich der Fokus auf die Definition von Jineolojî und ihre Beziehung zur Sexualität. Angesichts dieses neuen Fokus würde man erwarten, dass es für die Autor_innen noch wichtiger gewesen wäre, die von Jineolojî produzierten Materialien zu diesen Themen zu untersuchen. Doch wieder wird keine solche Anstrengung unternommen.
5. In ähnlicher Weise hätte ein Artikel, der argumentiert, dass Jineolojî keine neue Erkenntnistheorie entwickelt, zumindest eine Inhaltsanalyse der zuvor erwähnten Schlüsselpublikationen durchführen und die darin gemachten Aussagen zur Erkenntnistheorie einbeziehen müssen. Die Tatsache, dass die Autor_innen ein solches grundlegendes methodisches Kriterium nicht erfüllen, lässt auf eine Voreingenommenheit der Autor_innen schließen. Das heißt, Al-Ali und Käser scheinen zu glauben, dass die Frauenbefreiungsbewegung in Kurdistan, die trotz vieler Hindernisse zu diesen und anderen Themen geschrieben hat, eigentlich kein Wissen produziert, das es wert wäre, von Al-Ali und Käser berücksichtigt zu werden.
6. Der Artikel legt großen Wert auf die Beziehung von Jineolojî zu FLTIQ*-Identitäten. Doch obwohl die Autor_innen angeben, dass es eine beträchtliche Beteiligung von FLTIQ*-Personen in Jineolojî-Camps gibt, scheint nur eine Person interviewt worden zu sein. Diese Person wird als Symbol genommen und ihre Sichtweise so behandelt, als ob sie alle anderen FLTIQ*-Teilnehmer_innen repräsentiert.
7. Die Autor_innen beziehen sich häufig positiv auf transnationalen Feminismus, Dekolonialismus und viele andere kritische Feminismen. Forschung, die sich auf solche feministischen Ansätze stützt, stellt normalerweise horizontales Engagement als Methode in den Mittelpunkt. In diesem Artikel gibt es jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass die von den Autor_innen aufgestellten Behauptungen in irgendeiner Weise mit den Interviewpartner_innen diskutiert wurden. Zum Beispiel haben zwei von uns, die interviewt wurden, darum gebeten, den Artikel vor der Veröffentlichung zu lesen, haben aber nie eine Antwort von den Autor_innen erhalten. So scheint es, dass die Autor_innen ihre Interviewpartner_innen eher als Versuchspersonen betrachten, die benutzt werden sollen, statt als gleichberechtigte Partner_innen in einem kollektiv gestalteten Forschungsprojekt.
Vor allem weil Forschungen, die aus den untersuchten Gesellschaften selbst stammen, vernachlässigt wurden, fanden wir zahlreiche sachliche Fehler in dem Artikel:
1. In der Zusammenfassung und im Abschnitt zur Methodik des Artikels wird behauptet, dass die Forschung auf Interviews basiert, die mit Menschen geführt wurden, die an der Entwicklung von Jineolojî beteiligt sind. Wie jedoch aus dem Hauptteil des Textes hervorgeht, wurde die Mehrzahl der Interviews mit Mitarbeiter_innen von Jin TV geführt. Jin TV ist ein Fernsehprojekt, das kollektiv von kurdischen, arabischen, türkischen und europäischen Frauen geleitet wird. Das Fernsehen, das über Studios im Nahen Osten und in den Niederlanden verfügt, sendet wöchentliche Programme, darunter zwei über Jineolojî. Abgesehen davon hat Jin TV als Institution selbst keinen direkten Bezug zur Entwicklung und Verbreitung der Jineolojî. Wie wir bereits festgestellt haben, fehlen dem Artikel jegliche Informationen, die eine Überprüfung seiner Methoden ermöglichen würden (warum, wo, wie und wer befragt wurde). Daher ist der Inhalt des Artikels von Anfang an suspekt.
2. In Fußnote 11 wird behauptet, dass sich der Begriff «Wahrheit» der kurdischen Freiheitsbewegung auf das Leben in der neolithischen Gesellschaft bezieht. Damit wird suggeriert, dass die Bewegung glaubt, dass die Wahrheit nur durch archäologische und historische Ausgrabungen aufgedeckt werden kann. In Wirklichkeit ist die Wahrheit (hakikat) eines der wichtigsten Themen, dem die kurdische Freiheitsbewegung viele Jahre und viel Arbeit gewidmet hat, um es zu konzeptualisieren. Abdullah Öcalan führt diese Ideen in mehreren seiner Werke aus, Werke, die zwar zitiert, aber anscheinend von den Autor_innen nicht gelesen wurden. In verschiedenen Abschnitten des Buches „Building Free Life: Dialogues with Abdullah Öcalan“ (deutsch: „Das freie Leben aufbauen – Dialoge mit Abdullah Öcalan“), das die Autor_innen ebenfalls zitieren, diskutieren mehrere Akademiker_innen den Wahrheitsbegriff der kurdischen Freiheitsbewegung. Anstatt sich jedoch ernsthaft mit dem kurdischen Wahrheitsbegriff auseinanderzusetzen, beschränken die Autor_innen das Thema auf eine irreführende Fußnote.
3. Die Aussage auf Seite 12, die kurdische Frauenbewegung habe in Diyarbakir ein Jineolojî-Zentrum gegründet, das anschließend vom türkischen Staat geschlossen worden sei, ist nicht korrekt. Außer dem Jineolojî-Magazin, das in 2016 in Diyarbakir gegründet und veröffentlicht wurde (und weiterhin erscheint), gibt es keine formale Institution, die unter dem Namen Jineolojî arbeitet. Dies ist ein Fehler, der hätte vermieden werden können, wenn die Forscher_innen die Gelegenheit ergriffen hätten, das Diyarbakir-Büro des Jineolojî-Magazins in ihrer Feldforschungsperiode (2015-2018) zu besuchen, um mit seinen Herausgeber_innen zu sprechen. Dies lässt den Schluss zu, dass die Autor_innen kein Problem damit haben, ihrem Publikum Informationen zu präsentieren, ohne die notwendige Faktenüberprüfung vorzunehmen.
4. Auf den Seiten 22 und 23 behaupten die Autor_innen aufgrund ihrer Vorrecherchen und der Aussagen ihrer Gesprächspartner_innen, dass die Lehrpläne der Jineolojî im Nahen Osten und in Europa gleich sind. Sie spezifizieren dann die Themen in einer Fußnote. Auch dies ist nicht korrekt. Jineolojî-Workshops und -Seminare mögen zwar viele gemeinsame Themen haben, aber die Lehrpläne sind nach den Besonderheiten der jeweiligen Länder, ja sogar der jeweiligen Städte, bestimmt. Die Forscher_innen scheinen keine detaillierten Kenntnisse über die Lehrpläne der Jineolojî-Seminaren und -Workshops zu haben, wie sie speziell in Diyarbakir, Mardin und anderen Orten in Kurdistan stattfinden.
Bezüglich der Argumente des Artikels:
1. Die Frauen, die die Jineolojî entwickeln, arbeiten täglich an der Verfeinerung der Jineolojî und der Erweiterung ihres Umfangs. Wenn diejenigen, die die Jineolojî entwickeln, diese nicht auf eine exakte Definition festlegen, sondern sie als eine kollektive, fortwährende Anstrengung betrachten, warum greifen die Autor_innen dann auf eine Sprache zurück, die die Jineolojî einschränkt, ja regelrecht diskreditiert, indem sie autoritäre Behauptungen für sie aufstellen? Außerdem, obwohl die „Einführung in die Jineolojî“ (Jineolojî’ye Giriş) sowie alle schriftlichen und mündlichen Quellen der Jineolojî immer wieder betonen, dass die Jineolojî aus dem Erbe der globalen und historischen Frauenkämpfe, der feministischen Bewegungen und des kurdischen Frauenbefreiungskampfes schöpft, warum beharrt der Artikel dann auf der Behauptung, dass die Jineolojî sich weigert, die lange Geschichte des feministischen Kampfes anzuerkennen?
2. Ein weiterer widersprüchlicher Ansatz des Artikels ist die Betonung der Standpunkttheorie, mit viel Fokus auf die Ideen von Patricia Hill Collins, obwohl die im Text eingenommene Haltung in völligem Gegensatz zu diesen Werken steht. Solche Ansätze argumentieren, dass Frauen wichtiges, auf ihren Erfahrungen und besonderen lokalen Gegebenheiten basierendes fundiertes Wissen über soziale Phänomene entwickeln. Erstaunlich ist jedoch, dass die Autor_innen die Art und Weise, wie sich die kurdische Frauenbewegung definiert, ablehnen.
3. In den Augen der Autor_innen zeigt der Verzicht der weiblichen und männlichen Guerillas in der Freiheitsbewegung Kurdistans auf sexuelle Beziehungen, dass kurdische Frauen trotz aller Ansprüche unterdrückt bleiben. Warum werden, während im Westen Asexualität als queere Identität akzeptiert wird, angesehene Feministinnen wie Adrienne Rich von «Zwangsheterosexualität» sprachen und Schwarze Feministinnen wie Audre Lorde wegweisend von Erotismen außerhalb der Sexualität sprachen, die politische Entscheidung der kurdischen Frauenbewegung, sich unter patriarchalen Bedingungen für Asexualität zu entscheiden, und ihr Kampf um die philosophische Bedeutung der Liebe in Bezug auf Begriffe wie Freiheit, Natur, Leben und Menschlichkeit von Al-Ali und Käser als Formen der Unterdrückung des Begehrens gesehen? Man fragt sich, ob die Autor_innen eine solche Behauptung in einem anderen Kontext als dem des Nahen Ostens hätten aufstellen können, wo immer davon ausgegangen wird, dass Sexualität unterdrückt wird, und ob die Herausgeber_innen dann bemerkt hätten, dass diese Form der Argumentation weit von feministischer Solidarität entfernt ist, etwas, das die Autor_innen anzustreben behaupten?
4. Die Position der Frauenbefreiungsbewegung in Kurdistan, dass ein großer Teil der sexuellen Beziehungen von Frauen zu Männern einen vergewaltigenden Charakter hat, ist ein Produkt jahrelanger Erfahrungen, Forschungen, kollektiver Diskussionen und Theoretisierungen. Diese Sichtweise wird von den Autor_innen als essentialistisch vereinfacht, die zudem verzerrend behaupten, dass Jineolojî alle Männer als Vergewaltiger definiert. Seit mehr als zwei Jahrzehnten diskutiert und entwickelt die kurdische Frauenfreiheitsbewegung Projekte zur Transformation von Männern und zur Abschaffung dominanter und gewalttätiger Formen von Männlichkeit. Hätten die Forscher_innen die Literatur der Bewegung konsultiert, hätten sie gesehen, dass die Herangehensweise an Männlichkeit und Sexualität nicht essentialistisch, sondern grundsätzlich transformativ ist.
5. Zu den zeitgenössischen Kritiken in der dekolonialen feministischen Literatur an weißen Feminist_innen gehört die Tatsache, dass der westliche Feminismus genau die gleiche Konzeptualisierung und Praxis von FLTIQ*-Identitäten, die es in den progressiven Kreisen des Westens gibt, überall auf der Welt diktiert und alle radikalen Bewegungen abwertet, die an anderen Konzeptualisierungen und Praktiken festhalten. Was oft als «Pinkwashing» bezeichnet wird – andere Unterdrückungen unsichtbar zu machen – ist eine Art und Weise, in der weiße Feminist_innen einmal mehr mit Kolonialismus und Imperialismus kollaborieren: Ohne die fortschrittliche Intervention des Westens sei keine autonome Entwicklung von Denkschulen im Globalen Süden möglich. Dieser Artikel ist ein Beispiel für diese Haltung. Davon abgeshen sind wir der festen Überzeugung, dass die Kritik, die aus FLTIQ*-Perspektive an Jineolojî geäußert wird, wertvoll ist, und wir begrüßen das transformative Potenzial, das die Auseinandersetzung mit diesen und anderen konstruktiven und fundierten Kritiken für unsere Praxis bietet.
Fazit:
Es ist von größtem Wert, dass die Autor_innen des Artikels Kritik an der Jineolojî üben wollen, wie es von jeder Frauensolidarität verlangt würde. Wenn wir jedoch die Verwendung ihrer Daten, die Positionen, die sie einnehmen, und die Sprache und die Methoden, die sie verwenden, betrachten, kommen wir zu dem Schluss, dass ihr Ziel, statt Kritik zu üben, darin besteht, unsere Arbeit zu bevormunden und zu banalisieren, und ihren eigenen Standpunkt durch diesen Artikel zu legitimieren und zu verbreiten.
Wir haben diesen Brief geschrieben, weil wir das Gefühl haben, dass der Artikel zur Verbreitung falscher Urteile über unsere Arbeit führen wird und wir deshalb diese falschen Wahrnehmungen korrigieren müssen. Akademische Ansichten, Vorschläge und Kritik an Jineolojî sind uns sehr wichtig. Wir halten es jedoch für bedeutsam, dass diese außerhalb der hegemonialen Perspektive der positivistischen Wissenschaftlichkeit und des orientalistischen Blicks in einer Weise formuliert werden, die den Kampf für die Befreiung der Frauen stärkt.
Wir finden es wichtig, dass Ihre Zeitschrift solchen Haltungen keinen Raum bietet und dass wir als Produzent_innen von Wissen über die Jineolojî die Möglichkeit erhalten, unsere Anliegen zu äußern und uns zu vertreten. In diesem Sinne bitten wir Sie, diesen Brief in Ihrer kommenden Ausgabe als Antwort auf „Beyond Feminism“ zu veröffentlichen und wir hoffen, dass Sie uns die Möglichkeit bieten, in Zukunft einen Artikel über die Jineolojî in Ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen.
Wir wünschen den Herausgeber_innen der Zeitschrift viel Erfolg bei ihrer Arbeit.